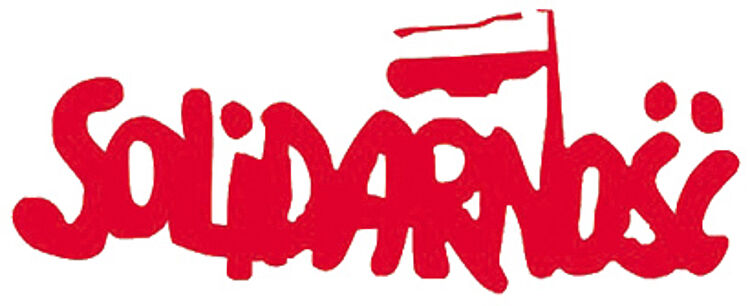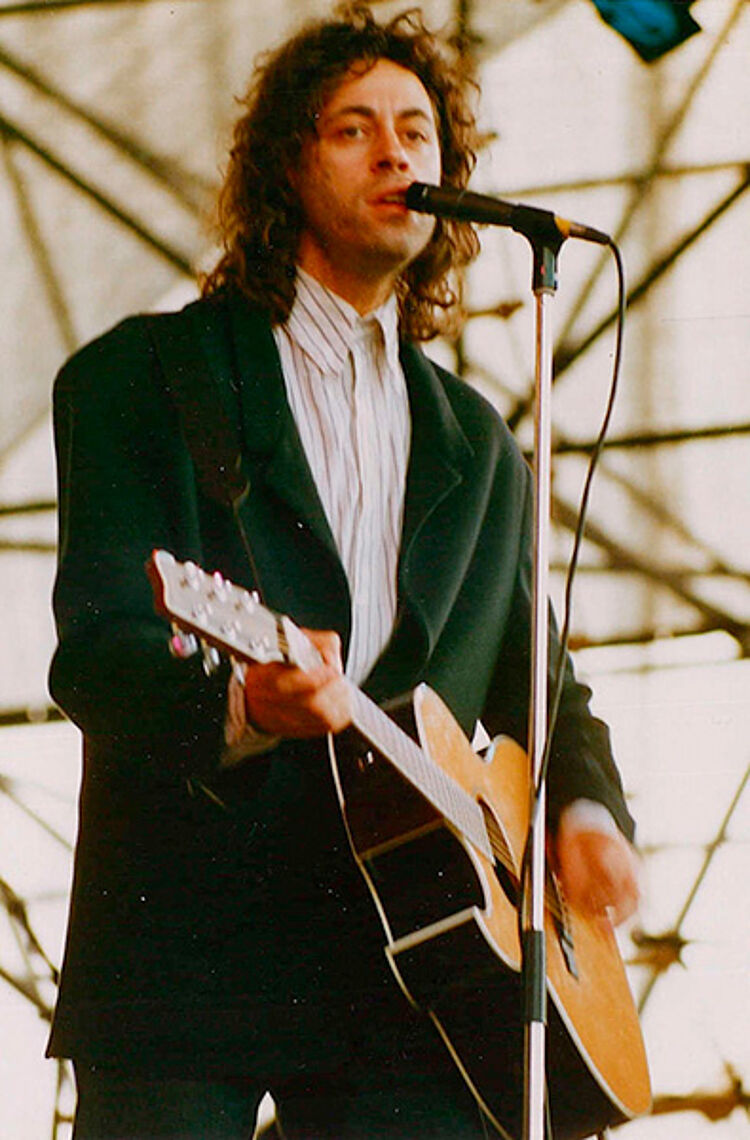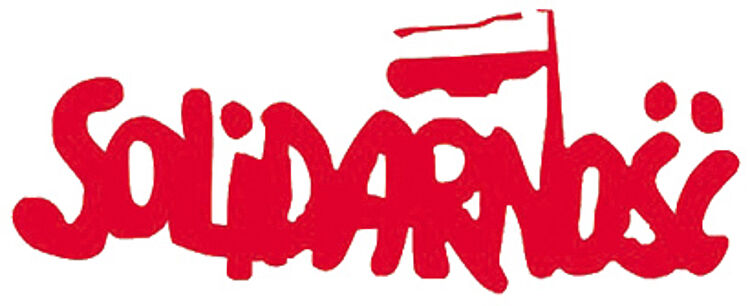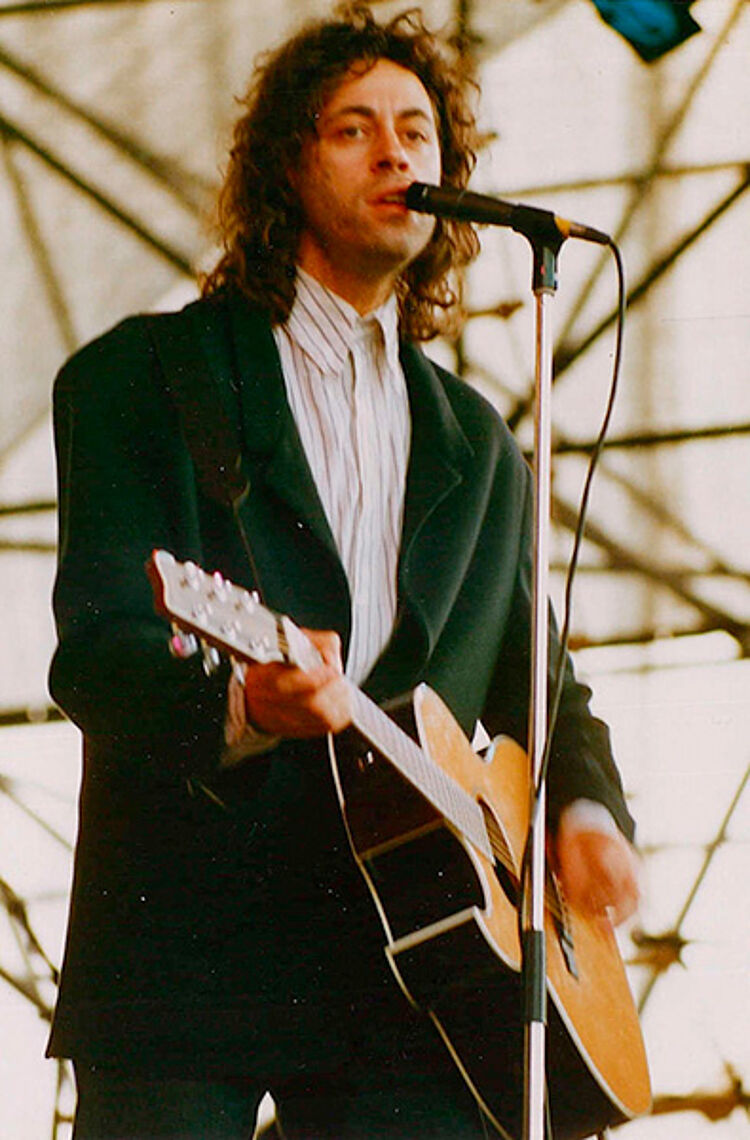Grenzenlose Solidarität, eine gerechtere Welt und eine bessere Verteilung von Reichtum sind wichtige Ziele. Solidarität ist aber auch in der Familie, der Schule oder in der Gemeinde wichtig. Der Umgang mit "Randgruppen", mit Schülerinnen und Schülern, die über kleinere finanzielle, intellektuelle oder sprachliche Möglichkeiten verfügen, prägen die Stimmung. Aggressives Ausgrenzen oder integratives Akzeptieren, für beides muss man sich aktiv entscheiden. Solidarität kann aber auch einen "Gruppendruck" erzeugen, der unabhängige Entscheidungen erschwert oder unmöglich macht. Solidarität setzt also voraus, dass jeder Einzelne eine Meinung hat und diese auch vertreten kann. Auch hier reicht eine theoretische Unterstützung nicht aus, sondern man muss auch entsprechend handeln und die Konsequenzen tragen.